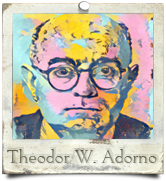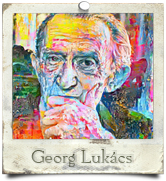„Die jüdische Religion, heißt es in der Dialektik der Aufklärung, dulde kein Wort, das der Verzweiflung alles Sterblichen Trost gewährte. Hoffnung knüpfe sie einzig ans Verbot, das Falsche als Gott anzurufen, das Endliche als das Unendliche. Indem das Judentum die falsche Versöhnung verweigere, halte es gegen den Weltlauf gerichtet die Möglichkeit für die wahre offen und unterscheide sich darin von allen anderen Religionen. Ins Vokabular der Aufklärung übersetzt, lautet der Impuls, der davon für die Kritische Theorie ausging und ausgeht: Die eigene Ohnmacht – die in den Formen liegt, in denen die Menschen sich reproduzieren – nicht zu verleugnen, sondern bewusst nachzuvollziehen, ihr auf den Grund zu gehen, gerade um seiner selbst mächtig zu bleiben. So wie dieser Prozess im Subjekt auf der einen Seite unmittelbar die besonderen therapeutischen Inhalte psychoanalytischer Praxis bildet, schlägt er sich auf der anderen mittelbar in eigenen mimetischen Formen nieder, soweit es um ästhetische Praxis geht. In beiden Fällen handelt es sich aber darum, dass die Verneinung falscher Versöhnung konkret werden muss und sich darin nicht scheut, bis zum Äußersten zu gehen.
So kritisierte Adorno das politische Engagement in Kunst, Literatur und Musik gewissermaßen als das Wort, das Trost gewährt, weil es die Ohnmacht nicht in allen Konsequenzen nachzuvollziehen erlaubt (es bildet sozusagen die ästhetische Variante zur „revidierten Psychoanalyse“). Zugleich ließ er es sich jedoch nicht nehmen, am Engagement in den Theaterstücken Brechts auch den inneren Widerspruch herauszuarbeiten: In diesen Stücken erfüllen die politischen Thesen „eine ganz andere Funktion, als die, welche sie inhaltlich meinten“; sie tragen bei „zum Zerfall der Einheit des Sinnzusammenhangs“ und zerrütten die klassischen und romantischen Formen, soweit diese der Ohnmacht des Einzelnen in der modernen Gesellschaft nicht mehr gerecht werden. Das mache die Qualität von Brechts Stücken aus, nicht das Engagement selbst, aber diese Qualität hafte am Engagement. So weise Brecht auf Becketts Endspiel voraus, ein Stück, das dem politischen Engagement vollständig entsagt und darum von Adorno ganz im Sinn jenes Diktums über die jüdische Religion aus der Dialektik der Aufklärung interpretiert wird.
Gerhard Scheit ist Autor, Herausgeber der Werke von Jean Améry sowie der sans phrase – Zeitschrift für Ideologiekritik. Seine Bücher erscheinen vor allem im Ca ira-Verlag, darunter Kritik des politischen Engagements (2016) und Quälbarer Leib. Kritik der Gesellschaft nach Adorno (2011).“
Webseite des Referenten: http://www.gerhardscheit.net
Der Vortrag wurde im Rahmen der Ring-VO: Der Kopf der Leidenschaft. Kritische Theorie und Gesellschaftskritik an der Universität Wien gehalten. Mitorganisiert von der Institutsgruppe Politikwissenschaft (BAK9): https://www.univie.ac.at/politikwissenschaft/strv/wordpress/?lang=de | Siebter Vortrag aus der Veranstaltungsreihe: https://www.facebook.com/events/1665375606839227/
Kategorien:Kritische Theorie´, Online Universität, Philosophie, Religion´, Vorträge